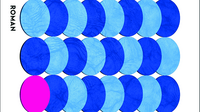„Frankfurt-Sein in der Kirche auch leben“


Das heutige Europa braucht einen neuen Impuls der Humanisierung und der Menschlichkeit. Das sagte Vincenzo Viva, Bischof der italienischen Diözese Albano und Gastzelebrant des diesjährigen Karlsamts, in seiner Predigt am Samstagabend im Bartholomäusdom. „Die globalen Krisen, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, wie Kriege, nationaler Egoismus, Migration, wachsende Ungleichheiten, Umweltkatastrophen, fordern uns dazu auf, erneut aufzubrechen, als Europäer, aber mit einem breiteren Wertesystem und mit neuer Zuversicht“, so Viva. Menschlichkeit bedeute heute, Lösungen zu finden und dabei der Versuchung zu widerstehen, sich selbstbezogen auf die eigene Identität zurückzuziehen und selbst für überlegen zu halten. „Unsere Aufmerksamkeit muss sich heute auf den Aufbau einer größeren Menschheitsfamilie richten, die mehr Völker und menschliche Situationen umfasst als in der Vergangenheit“, so der Bischof. Nötig seien dafür ein verfeinertes Hören auf die Realität und auf Verschiedenheiten, eine Suche nach gemeinsamen Werten sowie neue Wege der Brüderlichkeit und der Harmonie mit der Schöpfung. Die Predigt, für die es im Dom langanhaltenden Applaus gab, ist in gesamter Länge unten zu finden.













Erneut war der Dom bis auf den letzten Platz gefüllt, als Pia Arnold-Rammé, gemeinsam mit Stadtdekan Johannes zu Eltz Leitung der katholischen Region Frankfurt, die mehr als 600 Anwesenden begrüßte. Nach dem feierlichen Einzug der Ordensleute aus den katholischen Ritterorden und Ordenskongregationen, die wie immer von zahlreichen Schaulustigen vor dem Dom gesäumt wurde, begrüßte der Limburger Bischof Georg Bätzing, gemeinsam mit dem Stadtdekan Kozelebrant, den Gastbischof. Während des gut zweistündigen Gottesdienstes gab es eindrucksvolle Musik der Frankfurter Dombläser sowie von Vokalquartett und Choralschola St. Bartholomäus, Gesang von Domkantorin Hermia Schlichtmann und Domkantor Johannes Wilhelmi sowie Orgelspiel von Dommusikdirektor Andreas Boltz unter Leitung von Bezirkskantor Peter Reulein. Marianne Brandt und Monika Humpert aus dem Vorstand von Stadtsynodalrat und Stadtversammlung der Frankfurter Katholik:innen, waren als Lektorinnen eingebunden.
Aufgeschlossenheit und Offenheit
Jedes Jahr findet das Karlsamt am letzten Samstag im Januar statt – und immer ist ein anderer europäischer Bischof zu Gast. Vincenzo Viva bildete dabei allerdings eine Ausnahme, denn er ist nur zum Teil Gast: Der heutige Bischof von Albano wurde1970 in Frankfurt geboren, wuchs in Rödelheim auf und verbrachte die ersten 16 Jahre seines Lebens in der Stadt am Main. Da konnten weder Stadtrat Bernd Heidenreich, der Bischof Viva im Namen der Stadt am Nachmittag im Kaisersaal des Römers begrüßte, noch Bischof Georg Bätzing im Dom widerstehen, den Gast als „Frankfurter Bub“ zu bezeichnen.
Wie sehr das zutrifft, zeigte sich in den herzlichen Worten, die Bischof Viva über „seine“ Stadt („unser Frankfurt“) zu sagen hatte. Seiner damaligen Gemeinde St. Antonius in Rödelheim, die heute zur Pfarrei St. Marien gehört, ist er bis zum heutigen Tag von Herzen verbunden, das wurde im Dom, aber auch am Nachmittag beim städtischen Empfang und beim anschließenden Domgespräch im Haus am Dom mit Direktor Joachim Valentin deutlich, bei dem Viva erzählte: „In St. Antonius wurde mir ganz konkret gezeigt, wie man das Wort Gottes in unserer modernen Zeit leben kann.“ Unter anderem war Vincenzo Viva später im Leben acht Jahre Regens eines Missionsseminars mit hunderten von Seminaristen und Priestern der jungen Kirchen – „und ich glaube, dass ich diese Aufgabe mit dem Frankfurter Geist der Aufgeschlossenheit und Offenheit erfüllt habe.“



Diesem Frankfurter Geist begegnet der italienische Bischof natürlich bei seinen regelmäßigen Besuchen am Main. „Ich fühle mich als Frankfurter und habe auch das Bedürfnis, öfter nach Frankfurt zu kommen“, sagte er auf die Frage Valentins, was es ihm bedeute, in diesem Jahr das Karlsamt zelebrieren zu dürfen. Leider könne sein Vater, der 1997 als erster Italiener für die CDU ins Frankfurter Stadtparlament gewählt wurde, nicht mehr erleben, wie der Sohn das Karlsamt feiere, denn er starb vor fast zwei Jahren. Viva betonte, er komme nicht nur immer wieder nach Frankfurt, „um Rippchen und Sauerkraut, grüne Soße und Handkäs zu essen, sondern auch, um diese Straßen zu sehen, durch die ich bis zum 16. Lebensjahr gelaufen bin.“ Es sei ihm ein Anliegen, mitzuerleben, wie die Stadt sich verändere. „Ich habe dieser Stadt gegenüber ein Gefühl der Dankbarkeit, ich spüre, dass die Lebenserfahrung hier in Frankfurt in mir weiterlebt.“ Die Anwesenden beim Domgespräch brachte er zum Schmunzeln mit folgender Anekdote: Ein Freund habe ihm mal gesagt, er sei wie ein Auto mit einer italienischen Karosserie, aber mit deutscher Technologie.
Holpriger Start in Italien
Es sei für ihn nicht leicht gewesen, als seine Eltern damals entschieden, zurück nach Italien zu gehen. Für ihn, der in Frankfurt fest verwurzelt und in St. Antonius auch Messdiener war, ein Bruch im Leben. „Der Übergang nach Italien war auch von der Schule her ein großes Problem, ich hatte Schwierigkeiten mit der Sprache.“ Nach dem Abitur in Italien ging er zum dortigen Pfarrer und sagte, er wolle Priester werden. In einem Seminar in Rom studierte Viva Philosophie und Theologie, fand besonders Gefallen an der Moraltheologie, unterrichtete auch Bioethik und fand immer, sein Frankfurter Hintergrund ermögliche es ihm, auf Menschen zuzugehen und andere Perspektiven zu verstehen: „Dabei ist ein gewisser Pluralismus von großem Nutzen gewesen.“
Über das Karlsamt
Für viele Frankfurterinnen und Frankfurter ist das das Pontifikalamt, das die katholische Kirche in Frankfurt alljährlich zum Todestag Karls des Großen feiert, eine wichtige Tradition. In einer einzigartigen Liturgie erklingen mittelalterliche lateinische Gesänge wie die Karlssequenz, ein Lobgesang auf Kaiser und Stadt, und die Kaiserlaudes, in der Huldigungsrufe an Christus mit Bittrufen für Kirche, Papst, Bischof, das deutsche Volk und alle Regierenden verbunden werden. Das Karlsamt wird in Deutschland nur in der Karlsstadt Aachen und in Frankfurt gefeiert, wo im Mittelalter die deutschen Kaiser gewählt wurden. Hauptzelebrant und Prediger ist jedes Jahr ein anderer europäischer Bischof.
Durch die Migrationsgeschichte seiner Familie habe er sein ganzes Leben lang in zwei Welten gelebt, räumte Viva ein: „Wichtig ist vor allem, dass man als Migrantenkind diese beiden Welten annimmt und sie anerkennt.“ Seine eigene Geschichte hilft ihm auch dabei, den Blick auf die Weltkirche weit zu halten. „Auch wir haben in Italien Katholikinnen und Katholiken mit Migrationsgeschichte, zum Beispiel von den Philippinen und aus Lateinamerika. Diese muttersprachlichen Gemeinden dürfen keine Ghettogemeinden werden. Sie müssen integriert sein, es ist wichtig, Gelegenheiten zum gemeinsamen Gespräch und Gottesdienst zu finden.“
Europäische Kirche hat besondere Aufgabe
Unterschiede gebe es, das schon. Viva sagte, es sei wichtig, die katholische Kirche als Harmonie der Differenzen zu sehen. „Wir brauchen sehr viel Geduld, aber wir dürfen nicht darauf verzichten, neue Wege zu schlagen, neue Meinungen zu wagen. Ich glaube, dass die europäische Kirche diese besondere Aufgabe hat.“ Wichtig sei es, diesen Weg nicht alleine zu gehen, sondern die Anderen, die Weltkirche mitzunehmen. Dabei dürfe die Kirche auch das Band zur Gesellschaft nicht verlieren, selbst wenn es immer schwieriger werde, Menschen anzusprechen.
Von Joachim Valentin auf die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre rechtsgerichtete Regierung angesprochen, sagte Bischof Viva, es gebe immer die Gefahr, Identitäten zu übertreiben. „Die Frage der Migration ist eine Große, wir als Italiener fühlen uns ein wenig verlassen.“ Die Grenzen Europas seien im Mittelmeer, das mittlerweile der größte Friedhof Europas geworden sei. „Da können wir nicht wegschauen, aber eine Lösung dazu kann nur europäisch gefunden werden. Niemand sollte seine Nationalinteressen voranstellen, man muss als EU-Gesellschaft Antworten finden.“
Hat er auch einen Rat für die katholische Kirche in „seinem“ Frankfurt? „Was ich mitgeben möchte ist, dass wir unser Frankfurt-Sein in der Kirche auch leben sollten. Offenheit, Pluralität, Fleiß, positiv auf die Zukunft schaut. Man darf hoffen, dass wenn man sich anstrengt, auch etwas dabei herauskommt.“ Auf die Kirche übertragen bedeute das, dass man noch mehr auf die Universalität der Kirche vertrauen sollte – „denn es gibt noch viel zu lernen, auch von denen, die weit weg sind.“
DOMGESPRÄCH MIT BISCHOF VIVA
Externer Inhalt
Dieser Inhalt von
youtube.com
wird aus Datenschutzgründen erst nach expliziter Zustimmung angezeigt.
KARLSAMT MIT BISCHOF VIVA
Externer Inhalt
Dieser Inhalt von
youtube.com
wird aus Datenschutzgründen erst nach expliziter Zustimmung angezeigt.
Predigt von Bischof Vincenzo Viva
Frankfurt am Main, Kaiserdom St. Bartholomäus
27. Januar 2024
Dtn 18,15-20
Mk 1, 21-28
«Was haben wir mit Dir zu tun, Jesus von Nazaret?»(Mk 1, 24): diese stürmischen und unbequemen Worte erklingen aus dem Mund eines besessenen Menschen, den wir heute im Markusevangelium treffen. Es ist nicht nur der Schrei eines gestörten Menschen, sondern vielleicht auch die ursprünglichste Reaktion, die jede Person gegenüber dem Evangelium Christi haben kann. Wenn wir das Wort des Evangeliums ernst nehmen und wirklich auf unser Leben und unsere Zeit auslegen, dann löst das Evangelium unweigerlich ein Gefühl der Fremdheit, ein beißendes Unbehagen, eine eindringliche und dauerhafte Provokation aus. Das war schon immer so und wird auch für den heutigen Menschen so bleiben. Es ist einfacher, sich in eigenen Gewissheiten wohlzufühlen, an unserem Ich haften zu bleiben, an unseren gewohnten Vorstellungen, unserem mehr oder weniger bewussten Zusammenleben mit dem Bösen und an unserer Illusion unbegrenzter Autonomie, ohne Solidarität mit anderen zu hängen. «Unrein», wie dieser Mann im Markusevangelium beschrieben wird, bedeutet ja im biblischen Kontext «der Gotteswelt entfernt», von der Gemeinschaft getrennt, bewohnt von bösen Gedanken des Egoismus, die nicht von außen kommen, sondern aus dem Herzen des Menschen (vgl. Mth 15, 19-20).
Das Wort Jesu ist somit ein kraftvolles Wort, das uns in Frage stellen kann und Heilungs- und Befreiungsprozesse vom Bösen bewirkt. «Schweig und verlass ihn!» (Mk 1, 25): Mit diesem Machtwort beginnt der «messianische Tag» im Leben Jesu nach dem Markusevangelium. Es scheint, als ob der Evangelist sofort klarstellen möchte, dass das Wort Jesu nicht nur ein menschliches und weises Wort ist, sondern ein «Vollmachtwort», ein Wort, das eine göttliche Wirkung hat, ein Wort – wie der Apostel Paulus sagen würde – das «wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; vor dem Wort Gottes bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen Gottes» (Hebr 4, 12-13). Tatsächlich, sagt Markus, «die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten» (Mk 1, 22).
Gleich zu Beginn des Markusevangeliums werden wir also daran erinnert, dass Jesus wirklich ein Prophet, ein Lehrer und Befreier ist, genau im Sinne der Erwartungen Israels. Gott hat seinem Volk versprochen, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, dass er die Prophezeiung niemals untergraben wird: dieser Prophet ist von Gott berufen, er ist ein Bruder unter Brüdern, unter seinem Volk; kein extravaganter Mensch, sondern ein normaler Mann, der in normalen Situationen lebt und dem die Aufgabe anvertraut ist, die Bedeutung der Dinge zu entschlüsseln und Worte der Wahrheit auszusprechen. «Auf ihn sollt ihr hören (…) Den aber, der nicht auf meine Worte hört, ziehe ich selbst zur Rechenschaft» (Dtn 18, 15.19).
Die Gelegenheit dieses feierlichen Pontifikals zum Gedenken an den Todestag Karls des Großen lädt uns ein, den Blick auf Europa zu richten. Wenn wir versuchen wollen, das gerade gehörte Wort Gottes auf diesen europäischen Anlass hin auszulegen, sollten wir uns fragen, ob das Wort Jesu immer noch eine Prophezeiung für unsere Zeit und unseren Kontinent ist? Hat das Evangelium mit seinen Inhalten und seinen eindringlichen Perspektiven uns heute noch etwas zu sagen, die wir in gewisser Weise doch die Erben der Idee eines vereinten, auf christlichen Werten basierenden Europas sind? Oder befinden wir uns vielleicht in der Situation dieses Menschen aus dem Markusevangelium, der zumindest auf theoretischer Ebene gut wusste, wer Jesus ist, in Wirklichkeit aber in sich selbst blockiert, ruhelos, von bedrückenden Gedanken besessen war; ja sogar «unrein», also in Not mit sich selbst, mit seiner Umwelt und mit Gott? Glauben wir, ehrlich gesagt, an die verwandelnde Kraft des Evangeliums?
Sicherlich ist das Europa Karls des Großen nicht das heutige. Wir sind zeitlich so weit weg und es ist inzwischen viel Wasser unter den Brücken des Main geflossen. Einerseits müssen wir erkennen, dass mit Karl dem Großen effektiv erstmals ein einheitlicher politischer, verwaltungsmäßiger, rechtlicher und kultureller Raum in Europa geschaffen wurde, der von Hamburg bis zu den Toren Benevents in Süditalien, von Wien bis Katalonien in Spanien reichte, mit seinem Schwerpunkt in Kontinentaleuropa, also zwischen Deutschland und Frankreich. Andererseits scheint diese Realität sehr weit von uns entfernt zu sein und schließt Völker und Gebiete aus, die heute selbstverständlich zu unserer Vorstellung von Europa gehören. Es ist jedoch kein Zufall, möchte ich sagen, dass uns genau dieses Kontinentaleuropa, mit seinen germanischen und lateinischen Wurzeln, mit seinem Verwaltungszentrum gerade zwischen Brüssel, Straßburg und Maastricht, mit seiner regelmäßigen Ungeduld gegenüber den Mittelmeerregionen, mit seinem gewissen Misstrauen gegenüber den Völkern des Ostens und heute wieder ohne Großbritannien (zumindest was die Europäische Union betrifft), uns doch irgendwie heute noch sehr vertraut ist: gut und gerne erinnert es uns an das Europa Karls des Großen.
In meiner persönlichen Lebensgeschichte kann ich wohl sagen, dass ich mit einem ausgeprägten Ideal der europäischen Einheit aufgewachsen bin: als Sohn italienischer Emigranten habe ich, seit meiner Kindheit, in dieser Stadt die Begegnung der Kulturen, die Offenheit gegenüber anderen, die Akzeptanz von Differenzen und die Bestrebung nach Inkulturation verspürt. Hier, in Frankfurt, lernte ich vor allem durch das Lebenszeugnis meiner Eltern und vieler guter Menschen die Konkretheit und den Wert der Arbeit sowie die Bedeutung von Opferbereitschaft. Deshalb freute es mich, als ich in den neunziger Jahren während eines Besuchs in Frankfurt entdeckte, dass in der Nähe der Messe die riesige Skulptur von Jonathan Borowsky, der «Hammering Man», aufgestellt wurde: nicht nur als Wahrzeichen dieser Stadt, sondern auch als Symbol der Solidarität mit den Frauen und Männern, die in Vergangenheit und Gegenwart, aus allen Ländern und Kulturen, mit ihrer Arbeit und Opferbereitschaft zum Wohl einer Gesellschaft beigetragen haben.
Die Siebziger- und Achtzigerjahre waren vor allem von europäischer Migration geprägt, was sicherlich viele Dinge im Vergleich zu heute vereinfacht hat. Allerdings waren wir in gewisser Hinsicht die ersten Kinder von Emigranten, deren Eltern noch stark mit ihren Wurzeln verbunden waren, und deshalb fühlten wir uns (und fühlen uns auch heute noch in einem gewissen Maß) immer zwischen zwei Welten hin- und hergerissen. Wir waren unter den Ersten, die ein sehr selektives und meritokratisches Schulsystem überwunden haben und es geschafft haben, zum Gymnasium zugelassen zu werden: das war damals für ein Ausländerkind keine Selbstverständlichkeit. In der Aufopferung meiner Eltern konnte ich erleben, wie wahr die poetischen Worte von Dante Alighieri waren, unserem Nationaldichter, den ich später im Studium traf: «Dann wirst du fühlen, wie das fremde Brot / So salzig schmeckt und welch ein harter Pfad es ist / Die fremden Treppen auf- und abzusteigen» (Göttliche Komödie, Paradies XVII, 58). Ja, Emigrationsgeschichten haben halt alle einen gewissen bitteren Beigeschmack, aber sie bereichern nicht nur diejenigen, die sie am eigenen Leib erfahren, sondern sie sind auch Wachstumsfaktoren und Chancen zur Humanisierung für die Städte und Gesellschaften, die sie willkommen zu heißen und zu begleiten wissen.
Wer heute in Europa lebt und, wie ich, mit ausgeprägten Idealen der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, des Friedens, der Bedeutung von Familie, der Solidarität und der Gerechtigkeit aufgewachsen ist, erkennt unweigerlich, dass wir in Zeiten leben, in denen die Stützpfeiler und viele Gewissheiten der alten Welt zerfallen. Gleichzeitig sehen wir beeindruckende neue Möglichkeiten und Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Technologie und der Digitalisierung, in einem Kontext von so schnellen Wandlungen, dass es uns schwerfällt, die Merkmale dessen zu erkennen, was mühsam zu entstehen erscheint, nicht nur im schlechten, sondern auch im guten Sinne. Als Christen fragen wir uns, was Jesus und die Kraft seines Evangeliums unserer Zeit zu sagen haben?
Eigentlich müssen wir doch sagen, dass hinter den Veränderungen unserer Zeit wieder die Frage nach dem Menschen und seinem Schicksal in den Mittelpunkt rückt, die ja sehr eng mit unserem Glauben verbunden ist. Gerade hier sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Europa über ein außerordentliches Erbe an Werten und Denkkulturen verfügt, die von humanistischen Traditionen inspiriert sind, sowohl von religiöser als auch säkularer Herkunft, und die es verdienen, revitalisiert und aktualisiert zu werden. Aber eine einfache Kopie der Vergangenheit ist Fehl am Platz und vielleicht auch gefährlich. Das Wort «Humanismus» mag heute vielleicht den Beigeschmack von altmodisch haben und unter dem Gewicht einer komplexen, zumal eurozentrischen Geschichte leiden, aber man sollte diesen Begriff nicht vorschnell beiseitelegen.
Humanismus bedeutet letztlich «Menschlichkeit» in ihrer Fülle, in ihrer Würde, in ihrer Bedeutung des harmonischen Zusammenlebens zwischen den Menschen und mit der Schöpfung. Für uns Christen ist Jesus die Vollendung des Menschen: in ihm offenbart sich der Mensch, in ihm finden wir unsere höchste Berufung, in ihm – in seinen Worten und vor allem in seinen Gesten – haben wir ein Vorbild dessen, was «Menschlichkeit» eigentlich bedeutet (vgl. Gaudium et spes, 22). Auch unser heutiges Europa braucht einen neuen Impuls der Humanisierung und der Menschlichkeit. Die globalen Krisen, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, wie Kriege, nationaler Egoismus, Migration, wachsende Ungleichheiten, Umweltkatastrophen, fordern uns dazu auf, erneut aufzubrechen, als Europäer, aber mit einem breiteren Wertesystem und mit neuer Zuversicht. «Menschlichkeit» bedeutet heute, Lösungen für globale Probleme mit Denkmitteln zu suchen, die der Versuchung ausweichen, sich in die eigene Identität zu schließen, sich in Selbstbezogenheit und ausgrenzender Autonomie zu denken, immer anderen überlegend und polarisierend. Unsere Aufmerksamkeit muss sich heute auf den Aufbau einer größeren Menschheitsfamilie richten, die mehr Völker und menschliche Situationen umfasst als in der Vergangenheit: es geht dabei um ein verfeinertes Hören auf die Realität und auf Verschiedenheiten, um eine Suche auf gemeinsame Werteplattformen, um neue Wege der Brüderlichkeit und der Harmonie mit der Schöpfung.
Gerade das Evangelium, das wir gehört haben, lädt uns ein, die prophetische Kraft des Wort Gottes nicht zu ersticken; im Namen Christi mehr zu wagen und die Befreiung zu erfahren, die aus der Beziehung zu Jesus kommt: eine Befreiung von allem, was uns zu Gefangenen macht, was uns nur selbst in den Mittelpunkt stellt, getrennt von den anderen. Ich glaube, dass Papst Franziskus es in seiner Evangelii gaudium auf den Punkt gebracht hat, als er ein neue «Mystik des Zusammenlebens» für die Kirche und die Welt forderte, die darin besteht, «uns unter den anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns anzulehnen, teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine wahre Erfahrung von Brüderlichkeit verwandeln kann, in eine solidarische Karawane, in eine heilige Wallfahrt» (EG, 87).
Auch auf innerkirchlicher Ebene sollten wir vielleicht darüber nachdenken, dass dieser besessene Mensch, den wir im Markusevangelium getroffen haben, nicht an irgendeinem Ort saß, sondern in einem Haus des Herrn, und dem Wort Gottes lauschte. Die christliche Gemeinschaft in Europa, aber auch in jeder anderen Kultur und zu jeder Zeit, ist daher aufgerufen, sich daran zu erinnern, dass das Evangelium immer eine unbequeme und kratzende Realität bleiben muss; ein Wort also, das uns aus unseren gewohnten Perspektiven herausführt, die zu eng sind und sich vielleicht zu oft nur auf uns selbst und unsere eigene Geschichte konzentrieren. Ich denke, die synodale Dynamik lehrt uns genau das: die vielfältigen und schnellen Wandlungen in der Kirche und Gesellschaft sind mittlerweile unser tägliches Brot geworden. Wir müssen sie aus der Perspektive des Evangeliums betrachten und mit der Herausforderung, sie jedoch im Kontext einer universalen Kirche zu bewältigen. Dies ist eine große und schwierige Herausforderung für die Kirche in Europa, die es gewohnt war, sich oft als Mittelpunkt der Welt zu sehen. Der Pluralismus, mit dem der Glaube heute viel mehr als in der Vergangenheit zum Ausdruck kommt, lädt uns dazu ein, die Einheit der Kirche mehr im Sinne von Harmonie, von «Konvivialität der Unterschiede» (T. Bello) zu denken. Dies bedeutet gegenseitige Bereicherung, aber auch Respekt vor dem anderen, Geduld für Reifungsprozesse in einer globalen Welt und Kirche, Bestrebung nach gemeinsamen Wegen für den kirchlichen Zusammenhalt. Möge der Herr uns den Glauben schenken an die verwandelnde, heilende und prophetische Kraft des Evangeliums für eine wahre Erneuerung der Kirche in unserer Zeit. Amen.
X Vincenzo Viva
Bischof von Albano